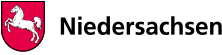Rede der Niedersächsischen Kultusministerin Frauke Heiligenstadt in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Hannover zum Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht
Es gilt das gesprochene Wort!
Anrede,
zur heutigen Veranstaltung anlässlich des Gedenkens an die Opfer der Reichspogromnacht begrüße ich Sie sehr herzlich.
Am 9. und 10. November 1938 schändeten die Nationalsozialisten überall in Deutschland jüdische Synagogen.
Synagogen wurden niedergebrannt, Geschäfte jüdischer Eigentümer zerstört und geplündert.
Jüdische Männer, Frauen und Kinder wurden misshandelt oder gar ermordet, in Konzentrationslager eingewiesen und zu demütigender Zwangsarbeit verpflichtet.
Auch in Hannover wurde am 9. November 1938 die Synagoge von einer johlenden Horde in Brand gesteckt, ohne dass Polizei oder Feuerwehr einschritten.
Der prachtvolle Bau aus dem 19. Jahrhundert in der Calenberger Neustadt galt als „Perle Hannoverscher Architektur“ und brannte in dieser Nacht bis auf die Grundmauern nieder.
Die Reste wurden später gesprengt.
Ebenso wurde die Kapelle auf dem jüdischen Friedhof in Bothfeld niedergebrannt. Außerdem verwüstete der antisemitische Mob 94 Geschäfte jüdischer Eigentümer und 27 Wohnungen oder Häuser.
Gleichzeitig verhafteten Polizei und SS mehrere Hundert jüdische Männer und brachten sie in das KZ Buchenwald bei Weimar.
Der Hannoveraner Jurist Dr. Horst-Egon Berkowitz beschrieb später das traumatische Erlebnis seiner Verhaftung in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938:
„Dann kam man auch zu mir. Gegen 1 Uhr morgens wurde mehrfach geklingelt, und es erschienen zwei Gestapo-Beamte, die mich verhafteten und aufforderten, mich anzuziehen und mitzukommen.
Ich kam dieser Aufforderung natürlich sofort nach, kleidete mich an und händigte zur Vorsicht meiner Ehefrau, die ‚arisch‘ war, meine Brieftasche, mein Geld und meine Schlüssel aus, da ich damit rechnen musste, dass man mir demnächst meine Sachen abnehmen würde.
Ich wurde zu einem offenen Lastwagen geführt, auf dem schon mehrere jüdische Herren standen, und nun ging es von Haus zu Haus jüdischer Mitbürger, die auf dem Lastwagen abtransportiert wurden.“
Der Transport endete im KZ Buchenwald.
Horst-Egon Berkowitz hatte Glück: Im Gegensatz zu vielen seiner Leidensgenossen wurde er als Kriegsfreiwilliger und Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg bald wieder entlassen.
Mit Not überlebte er die Shoah und beteiligte sich nach 1945 in Hannover am Wiederaufbau einer demokratischen Justiz in Niedersachsen.
Den meisten anderen Juden erging es bekanntlich anders.
Wer Geld und Beziehungen hatte und noch nicht verhaftet worden war, versuchte bis Kriegsbeginn noch auszuwandern.
Doch repressive Einwanderungsbestimmungen der meisten Staaten machten es vielen Juden unmöglich, ins rettende Ausland zu gelangen.
„Das Boot ist voll“, hieß es vielfach - Begrifflichkeiten und Denkweisen, die uns heute angesichts der sogenannten „Flüchtlingskrise“ sehr bekannt vorkommen.
Nach Kriegsbeginn am 1. September 1939 war der Weg ins rettende Ausland endgültig versperrt.
Die Lage der in Deutschland verbliebenen Juden wurde immer prekärer.
Die meisten mussten in sogenannte Judenhäuser umziehen, viele wurden zur Zwangsarbeit herangezogen, und im Spätsommer 1941, nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, wurde allen Juden in Deutschland das Tragen des gelben Davidsterns mit dem Buchstaben J vorgeschrieben. Damit waren sie endgültig als „Aussätzige“ stigmatisiert.
Überhaupt bedeutete der Überfall auf die Sowjetunion eine Beschleunigung und Radikalisierung der Ausgrenzungs- und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten - und das nicht nur in Ostpolen und den besetzten Gebieten der Sowjetunion, wo SS-, Polizei- und Wehrmachtseinheiten Hunderttausende erschossen, sondern auch in Deutschland.
Es jähren sich in diesen Tagen nämlich nicht nur die Novemberpogrome von 1938, sondern auch die ersten Deportationen niedersächsischer Juden in Ghettos und Lager im besetzten Osteuropa, namentlich nach Riga.
Dies geschah vor 75 Jahren, im Herbst 1941, also noch vor der sogenannten Wannseekonferenz, auf der schriftlich fixiert wurde, was bereits vorher in Gang gesetzt worden war: die vollständige Ermordung der europäischen Juden.
Und tatsächlich kam kaum einer der im Herbst/Winter 1941 nach Riga Deportierten jemals zurück.
Viele starben im Ghetto an den Folgen von Hunger und Krankheiten, andere wurden Opfer mörderischer Zwangsarbeit.
Weitere wurden erschossen oder in den Gaskammern der Vernichtungslager ermordet.
Ihrer gedenken wir heute.
Als Kultusministerin und Vorsitzende des Stiftungsrates der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten freut es mich, dass die Stiftung den 75. Jahrestag des Beginns der Deportationen aus Niedersachsen zum Anlass genommen hat, auf ihrem Bildungsportal „Geschichte.bewusst.sein.de“ mittels biographischer Beiträge zu verfolgten Juden aus allen Teilen Niedersachsens an diesen düsteren Abschnitt unserer Geschichte zu erinnern sowie Lehrerinnen und Lehrern Materialien bereitzustellen, um sich mit ihren Schülerinnen und Schülern kritisch damit auseinanderzusetzen.
Auch die Gedenkstätte Ahlem erinnert in ihrem Winter-Bildungsprogramm mit diversen Veranstaltungen an die Deportation und Ermordung der niedersächsischen Juden ab dem Herbst 1941. Sowohl die Veranstaltungsreihe in Ahlem als auch das Bildungsportal der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten zeigen, was der Kern unserer heutigen Erinnerungskultur ist:
Es geht darum, den Opfern die Identität zurückzugeben und sie zu würdigen, es geht aber auch darum, aus der Geschichte zu lernen, auch wenn sie heillos ist:
Dem Massensterben in den Ghettos und Lagern kann nicht im Rahmen einer politischen, religiösen oder metaphysischen Teleologie ein Sinn zugesprochen werden, jedenfalls nicht, wenn man die Opfer nicht instrumentalisieren möchte.
Gleichwohl lässt sich gerade am Beispiel der Shoah zeigen, wie eine radikal rassistische Gesellschaft funktioniert und welche Folgen das für Opfer, Täter und Zuschauer hat.
Der Nationalsozialismus unterschied im Rahmen seiner Volksgemeinschaftsideologie zwischen „Volks-genossen“ und „Gemeinschaftsfremden“, zwischen „produktivem“ und „unwertem“ Leben.
Es ging also um Ausgrenzung – Ausgrenzung in extremster Form.
Wie schleichend, aber zugleich gewalttätig der Übergang von antisemitischer Hetze der 1920er Jahre über formale Ausgrenzung ab 1933 und die aktive Verfolgung spätestens ab Mitte der 1930er Jahre bis zur Vernichtungspolitik verlief, das lässt sich mit allem Schrecken am Beispiel der Politik gegenüber den Juden im Nationalsozialismus nachvollziehen mit allem Schrecken, weil es fürchterliche Folgen für die Opfer hatte.
Aber auch nachvollziehen mit allem Schrecken, weil man feststellen muss, dass es ganz normale Deutsche waren, die diese Politik planten und ausführten und nicht nur eine Minderheit, sondern die Mehrheit.
Aktiv beteiligt waren nicht nur die Partei und der Polizeiapparat sowie die SS und die Wehrmacht, sondern auch Hunderttausende Verwaltungsbeamte in den Kommunen, in Arbeits-, Fürsorge- und Finanzämtern etwa, sowie Juristen, Lehrerinnen und Lehrer, Professoren und viele mehr.
Zu zeigen, wie die Ausgrenzungs- und Verfolgungspolitik funktionierte, welche Bindungskräfte sie innerhalb der propagierten „Volksgemeinschaft“ auslöste und welche Folgen sie für die Opfer hatte, das ist Aufgabe der Gedenkstättenarbeit.
Es ist aber auch Aufgabe der Schulen und Universitäten - und der gesamten Gesellschaft, und das nicht nur an Gedenktagen wie dem 9. November. Erinnern muss immer einhergehen mit einer aktiven Auseinandersetzung mit den historisch-politischen Zusammenhängen, aber mit dem Blick darauf, was wir aus der Geschichte lernen können, um unsere Demokratie zu stärken.
Gegenüber heutigen Formen des Rassismus, der Ausgrenzung und der Verletzung elementarer Menschenrechte kann eine solche kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nicht immunisieren.
Sie kann uns aber sensibilisieren und uns ermuntern, uns selbst auf der Grundlage eines kritischen Geschichtsbewusstseins anders zu verhalten:
das Leben und den Nächsten zu achten, für Solidarität mit Schwachen und Ausgegrenzten einzutreten sowie die Menschenrechte und unsere durch Vielfalt geprägte demokratische Gesellschaft zu stärken.
Das heißt aber auch, sich heutigen Formen der Ausgrenzung und Hetze entgegenzustellen, gerade in einer Zeit, in der Rechtspopulisten überall in Europa gegen Geflüchtete hetzen, nach wie vor gegen Juden, aber auch Sinti und Roma und gegen Muslime - häufig mit Denk- und Argumentationsmustern, die einem aus den 1930er Jahren bekannt vorkommen.
Das können wir nicht dulden. Und das dulden auch unsere Schulen nicht.
In vielfältiger Weise engagieren sie sich dafür, dass gemeinsame Werte wie Erziehung zum Frieden, Menschenrechte, Solidarität, Teilhabe und Gleich-wertigkeit aller in der Schulkultur gelebt werden.
Ein aktives Netzwerk, das hierfür in besonderer Weise steht, ist das Netzwerk der „Schulen ohne Rassismus – Schulen mit Courage“.
Seit mehreren Jahren wächst es kontinuierlich um etwa zwei Schulen pro Monat, so dass inzwischen bereits 256 Schulen in Niedersachsen mitwirken.
Es ist damit das zweitstärkste Netzwerk bundesweit. Hohes Engagement für Menschenrechte und gesellschaftliche Verantwortung zeichnet auch die niedersächsischen UNESCO-Projekt-Schulen aus.
In diesem Jahr fand in Goslar die Bundestagung aller deutschen UNESCO-Projekt-Schulen unter dem Motto statt „Schau hin – misch dich ein!“ Ich konnte mich vor Ort von der hohen Motivation und Gestaltungsfreude der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Lehrerinnen und Lehrer überzeugen.
Darüber hinaus engagieren sich viele Schulen in Niedersachsen im Bereich von Erinnerungskultur, indem sie eng und dauerhaft mit „ihren“ regionalen Gedenkstätten zusammenarbeiten.
Nicht nur zu besonderen Anlässen wie dem heutigen beteiligen sich Schulklassen, Schülergruppen und auch einzelne Jugendliche an Gedenkveranstaltungen und Projekten.
Sie halten damit die Auseinandersetzung mit der Geschichte lebendig, gedenken der Opfer und mahnen, dass eine gerechte, demokratische Gesellschaft keineswegs selbstverständlich ist.
Für eine solche Gesellschaft müssen und wollen wir uns immer wieder alle gemeinsam engagieren.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
Artikel-Informationen
erstellt am:
10.11.2016
Ansprechpartner/in:
Sebastian Schumacher
Nds. Kultusministerium
Pressesprecher
Hans-Böckler-Allee 5
30173 Hannover
Tel: 05 11/1 20-71 48
Fax: 05 11/1 20-74 51